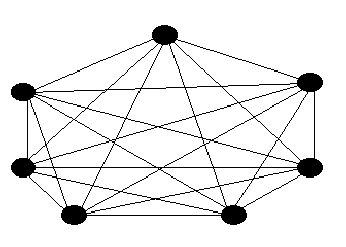- Begriff E-Commerce (sinngemäß)
- "E-Commerce" = elektronischer Handel
- Anbieter / Nachfrager tauschen Produkte auf Online-Weg aus
- Wirtschaftsgüter (Waren/Dienstleistungen) gegen Entgelt elektronisch angeboten
- E-Commerce Umsatz = Wert der übers Netz bestellten Waren/Dienstleistungen
Geschäftsmodell im E-Commerce
Verkauf & Vermietung
einfachste Handelsbeziehung zw. Zwei Parteien
- Autovermietung, E-Postfach (gmx, web.de, …)
- Autovermietung, E-Postfach (gmx, web.de, …)
Nutzungsrechte und Lizenzen
genauer: "Verkauf von Nutzungsrechten"
- musicload, napster, itunes music store
- musicload, napster, itunes music store
werbefinanzierte Inhalte
Internetnutzer erhält kostenlose Inhalte/Dienstleistungen vom Anbieter, der wiederum im Hintergrund Geschäftsbeziehungen mit dem werbenden Unternehmen hat
- freemailer (gmx, web.de), youtube, t-online, …
- freemailer (gmx, web.de), youtube, t-online, …
Vermittlung
- keine direkte Liefer-/Leistungsbeziehung zwischen Vermittler/Anbieter
der Vermittler übernimmt die Vermarktung
- Immobilien, Flugbörsen, Expedia, ...
- Immobilien, Flugbörsen, Expedia, ...
- keine direkte Liefer-/Leistungsbeziehung zwischen Vermittler/Anbieter
- Elektronische Beschaffung (E-Procurement)
Ziele der Beschaffung über elektronische Marktplätze:
- Beschleunigung ("time is money")
- Prozesskosten senken
- Produktauswahl erhöhen
- Produktkosten senken
- Lieferantenauswahl erhöhen
- Zentraleinkauf (Bündelung, Preise)
- Nachfragemacht bündeln
( → mögliche Klausurfrage dazu "Welche Ziele könnten Unternehmen mit E-Procurement verfolgen?")
Die Eignung der Produkte zur elektronischen Beschaffung steigt, je …
- einfacher der Transport
- höher der Standardisierungsgrad
- geringer die Komplexität
- höher der Normierungsgrad (Din XYZ) ist.
Mögliche Probleme des E-Procurement:
- Lieferant bietet Produkte nicht online an
- Produkte für elektronische Beschaffung ungeeignet
- fehlendes Know-How im Unternehmen
- zu hohe Einführungskosten
- zu hohe laufende Kosten
- Widerstand/Ängste im Unternehmen
- Elektronischer Absatz
Multi-Channel-Vertrieb
- Unternehmen hat mehr als einen Vertriebskanal
- im Handel meist: Verbindung von einem klassischen Vertriebskanal (stat. Laden und Katalog-Versandhandel) mit dem Internet-Vertriebskanal
Multi-Channel-Effekte
Wechselwirkungen, die sich innerhalb des Multi-Channel-Systems ergeben
- z.B.: Kannibalisierungseffekte der Vertriebskanäle untereinander
- Verbraucherinformation online und kauf im stat. Laden (und umgekehrt)
- bei welchen Produkten neigt der Käufer zum Multi-Channel-Shopping?
- Beratungsklau
- z.B.: Kannibalisierungseffekte der Vertriebskanäle untereinander
Vorteile/Chancen für die Nachfrage:
- Multi-Channel-Kaufanbahnung
- mehr Umsatz durch größeren Markt
- Kundenaquise
- höherer Anteil an den Kundenausgaben ("share of wallet")
- Erhöhung der Bestellfrequenz
- bei Multi-Channel-Unt. gg. reine Intershops: vermeiden von Vertrauensbruch
- bei Multi-Channel-Unt. gg. stat. Handel: Image aufpolieren
Nachteile/Risiken:
- Verwirrung der Kunden zwischen den Kanälen (Preise, Sortiment)
- Kunden werden preissensitiver durch mehr Vergleichsmöglichkeiten
- weniger Impulskäufe, da Kunden vermehrt auf dem Bestellweg kaufen
Vorteile/Chancen für die Anbieter:
- bei Einstieg auf vorhandene Infrastruktur aufsetzen (Initialkostenvorteil)
- Synergien zwischen den Kanälen (Kosten- oder Nutzenvorteil)
- Aufbau von Markteintrittsbarrieren
Nachteile/Risiken:
- Kannibalisierungseffekte der Kanäle (Mehrkosten des Online-Auftritts gg. geringen Mehrumsatz)
- erschwerte Erfolgsrechnung der einzelnen Kanäle
- Erhöhte Komplexität(skosten)
→ weiter nächste Seite
"Folgen" und Zusammenfassung der Multi-Channel-Kaufanbahnung
- Kannibalisierungsbefürchtungen sind meist übertrieben
- Anbahnung von stat. Käufen stellt bedeutenden Wertbestandteil des Internet dar
- → Multi-Channel-Unt. im Vorteil gg. Einkanal-Konkurrenten
Planung, Organisation und Realisierung von E-Commerce Projekten (S. 24)
Der Prozess im Überblick
Planung → Konzeption → Realisierung → Betrieb & Wartung → Controlling
Planung: (S. 24)
Definition der E-Commerce Ziele
- S pezifisch
- M essbar
- A ngemessen
- R elevant
- T erminiert
- S pezifisch
Wettbewerbsvergleich
- stationär kennt man seine Mitbewerber // Internet: riesen Zahl der Mitbewerber
- stationär kennt man seine Mitbewerber // Internet: riesen Zahl der Mitbewerber
Budget/Terminplanung
- realistische Kalkulation
- realistische Kalkulation
Projektorganisation
- betrifft alle Fachabteilung Meilensteine
- betrifft alle Fachabteilung Meilensteine
Konzeption: (S. 24)
- Anforderungskatalog aus Betrieber- / Nutzersicht
Technologieauswahl (Shopsystem)
- Eigenentwicklung
- Kauf-/Lizenzlösung
- Open Source Lösung
- Mietshop
- Outsourcing/Full E-Commerce Services
- Eigenentwicklung
Realisierung: (S. 27)
- Realisierung der Einzelkomponenten
- Prototyping
- Test und Qualitätssicherung
Betrieb & Wartung: (S. 28)
- Schulung und Training
- Content- & Datenpflege
Erfolgskontrolle (Controlling): (S. 28)
Tracking des Kaufverhaltens und der Systemnutzung
- Kennzahlen
- Webtool zur Analyse (googel Analytics)
- Auswertung
- Kennzahlen
Zahlungsverfahren für den E-Commerce
magisches Dreieck der Anforderungen aus Händlersicht:
- Kosten
- Schutz vor Zahlungsausfällen
- Akzeptanz der Kunden
Arten des klassischen Zahlungsverkehrs:
Rechnung
- keine Kontodaten anzugeben
- flexible Zahlung
- Händler muss in Vorleistung treten (Risiko)
- keine Kontodaten anzugeben
Nachnahme
- teurer für Kunde
- Bezahlung erst bei Lieferung (+)
- Händler muss lange auf Geld warten (-)
- hohe Kosten bei Retoure (-)
- nur bei hochwertigen Produkten sinnvoll
- teurer für Kunde
Lastschriftverfahren (ELV)
- Sicherheitsbedenken beim Kunden (-)
- Rücklastschrift möglich (+Gebühren) (-) für Händler
- Sicherheitsbedenken beim Kunden (-)
Vorauskasse
- Kunde muss in Vorleistung treten (-)
- Vertrauensfrage
- geringstes Risiko für Händler
- Überwachung des Zahlungseinganges von Nöten
- Kunde muss in Vorleistung treten (-)
Kreditkarte
- Vertrauensfrage
- technischer Aufwand
- Vertrauensfrage
Internetzahlungsverfahren:
- Zahlung via Intermdiär (Verfahren wie Paypal, moneybookers, ...)
- Online Banking
- Guthabenkarten (wie Handy Prepaid Karte)
E-Mail Marketing: Dialog über den virtuellen Postweg
Definition
- Einsatz von Email um mit Kunden in direkten Dialog zu treten
zeichnet sich aus durch
- Versendung von Werbebotschaften/Informationen per Email
- Emails werden nicht ohne vorherige Erlaubnis zugestellt
- sämtliche zugehörige Maßnahmen im Marketing-Mix integriert sind
- Versendung von Werbebotschaften/Informationen per Email
rechtliche Aspekte (S. 39 ff.)
Einwilligung ("Permission")
- "Single Opt-In" (einfache Registrierung mit Emailadresse → Missbrauch!)
- "Confirmed Opt-In" (autom. Bestätigung nach Reg. Mit Abmeldemöglichkeit)
- "Double Opt-In" (autom. Bestätigung mit Link zur Bestät. d. Reg.)
- "Single Opt-In" (einfache Registrierung mit Emailadresse → Missbrauch!)
wichtig bei Einwilligung:
- Eindeutige, bewusste Handlung
- Einwilligung muss kontrolliert werden
- Inhalt der Einwilligung muss jederzeit abgerufen werden können
- Eindeutige, bewusste Handlung
- Abbstellmöglichkeit
- Datensparsamkeit
- Anbieterkennzeichnung
- Datenschutzhinweise
- Nutzungsprofile
- Grundsatz der Wahrheit und Klarheit (.--> Werbung)
Formen des Email-Marketing
- eigner Email-Newsletter
- Aktionsbezogene Mailings
- Anzeigenschaltung und Sponsoring in fremden Newslettern
- Standalone Mails
- Email Abruf/Email Responder
Gestaltung von Emails
- Plain Text
- html
- Multipart
- Flash
- Video-Mail
Inhalte von E-Mailings
Absender:
- Firmenname & Adresse
- ggf. Name des Verfassers im Absender
- Firmenname & Adresse
Betreffzeile
- wichtigster Nutzen/Highlight der Email
- keine Spam-Unworte/Sonderzeichen
- als Handlungsaufforderung formuliert
- verschleiert nicht den Charakter der Mail (Werbung)
- wichtigster Nutzen/Highlight der Email
- Emails personalisieren über Datenbankfelder
- Email Inhalte priorisieren (basierend auf Interessensgebieten der User)
- Versandzeitpunkt individualisieren (häufig bei treuen Kunden, selten bei Geleg.)
- Inhalte individualisieren (eigentliche Stärke des Emailmarketing)
Adressen im Email Marketing
- Adressengewinnung = maßgeblicher Kostenfaktor im Email-Marketing
Adressgewinnung
- Integration der Newsletteranmeldung auf eingener Website
- Darstellung aller benötigten Informationen (Datenschutz, Kosten, Abbstellmöglichkeit, etc)
- Bekanntmachung durch Onlinewerbung
- Adressmiete mit Einverständnis bei Fremdanbieter
- Integration der Newsletteranmeldung auf eingener Website
Fremdadressen
- entscheidend ist Seriosität des Anbieters
- Finger weg von Adressen ohne Permission!
- Qualität der Adressen hinterfragen ("info@firma.de")
- entscheidend ist Seriosität des Anbieters
Der Email-Versand
Versandfrequenz
- Email = flüchtiges Medium
- "gut 2 Wochen – maximal 2 Monate"
- Email = flüchtiges Medium
Versandzeitpunkt
- Nachtversand = schlecht (Emails landen mit Rest im Postfach)
- Freitag = schlecht (viele räumen nur Büro auf)
- abhängig von Kundengruppe (Logfiles vom Server kontrollieren)
- Nachtversand = schlecht (Emails landen mit Rest im Postfach)
Responsemanagement
- Antworten der Kunden auf Email-Aktionen
wichtig dabei:
- Schnelligkeit der Beantwortung
- persönlich formuliertes Schreiben
- qulitativ hochwertige Aussagen
- juristische Verbindlichkeit
- generell: manuelles Management von Inbound Mails vs. Email-Response-Management-System (ERMs)
- Schnelligkeit der Beantwortung
Erfolgsfaktoren in der Zusammenfassung:
Permission:
- versenden nur mit Einwilligung (mind. Confirmed opt-in)
- Abgrenzung v. "schwarzen Schafen" - offener Umgang: Datenschutz/Permission
Relevanz:
- nur Mailing wenn auch was zu sagen
- Lesernutzen hat oberste Priorität
Bekannter Absender:
aussagekräftige Absenderadresse
- Rechtsvorschriften!
- Öffnungsrate der Emails
- Rechtsvorschriften!
Interessante Betreffzeile:
- Betreffzeile = Tranport des wichtigsten Nutzenargument
- dabei Rechtsvorschriften beachten (Verschleierung d. Kommerziellen Charakters!)
Gutes Inhaltskonzept:
- Inhalte persönlich, leserfreundlich strukturiert und prägnant
- interessanteste Inhalte zuerst (Leserfreundlich!)
Personalisierung:
- persönliche Begrüßung des Empfängers = MUSS!
Individualisierung:
- Emailinhalte abgestimmt auf pers. Bedürfnisse, Interessen, Wünsche d. Zielgruppe
- dazu Nutzung der Kundendaten
- Individualisierung = Relevanz beim Kunden
Passendes Format:
- Multipart Format um maximale Lesefrequenz zu erhalten
- ggf. Wahl durch den Leser welches Format
- vor dem Versand Lesbarkeit bei den Providern prüfen
- Leser explizit zur Handlung auffordern
- mit Links auf spezifische Seite verweisen (nicht Startseite!)
- Rechtsvorschriften einhalten
- abmelden so einfach wie möglich machen (Link/Hinweis in jeder Email)
- optischen Wert auf gut strukturierte Prozesse (Usability!)
Adressgenerierung:
- Newsletteranmeldung im sichtbaren Bereich der Startseite
- Newsletteranmeldung in jeden Bestell-/Registrierungsvorgang integrieren
- regelmäßger Versand (→ zeugt von Zuverlässigkeit)
- Änderung nur in Ausnahmefällen
- für jede Zielgruppe optimale Versandzeit und -frequenz herausfinden
- Maßnahmen und Instrumente um eigene Homepage in Suchdiensten zu platzieren
- Ziel: Listung möglichst weit oben → Sichtbarkeit für potentielle Kunden
- grundsätzlich: generisches vs. bezahltes Suchmaschinenmarketing
- wichtige Erfolge nur im Zusammenspiel von beiden Varianten
- gefunden werden ohne dafür zu bezahlen
→ Suchmaschinenoptimierung
- SEO (Search Engine Optimizing)
- SEO (Search Engine Optimizing)
- technischer Background von Nöten
- On Page Optimierung (auf der eigenen Seite)
- Off Page Optimierung (Maßn. auf fremden Seiten zur Steigerung der Popularität)
- Vorteile des gener. SEM: kostenlos / Glaubwürdigkeit höher
- gezieltes Erkaufen von Werbeplatzierungen
- geschaltete Anzeigen erscheinen bei bestimmten vordefinierten Suchbegriffen
- Bezahlung pro Klick auf Link
Begriffe suchen, die die eigenen Produkte beschreiben
- auch bei Mitbewerbern! (Quelltext der Seite "meta tags")
- auch bei Mitbewerbern! (Quelltext der Seite "meta tags")
- diese Begriffe auf tatsächliche Anfragebegriffe spiegeln
- Bereinigung der Begriffe (unnötige aussortieren)
- ausreichend Zeit und Sorgfalt verwenden! Hiervon hängt das Projekt u.U. Ab!
- TEXT³ – nur das kann der Spider lesen!
- mit erfahrenen Partnern zusammen arbeiten!
- Internet Auftritt regelmäßg prüfen/anpassen
- Anpassungen brauchen Zeit bis zur Wirkung!
- teuren Wettbewerb um populäre Begriffe vermeiden
- ansprechende Anzeigentexte!
- Ggf. auf extrem teure Top Platzierung verzichten und 2./3. Position wählen
- nur für Unternehmen tatsächlich relevante Begriffe verwenden
- ggf. einzelne Wörter von der Suche ausschließen
- Suchwort im Anzeigentext!
- Verlinkung der Anzeige gleich auf Seite!
- Regelmäßge Überprüfung des Kampagnenerfolges!
- Keywordauswahl, Anzeigentexte ständig prüfen!